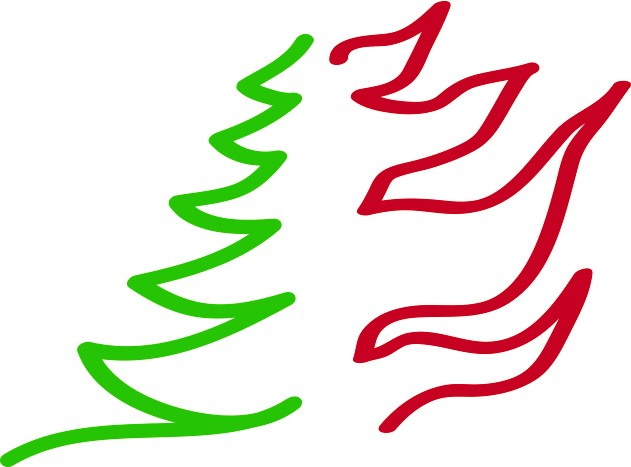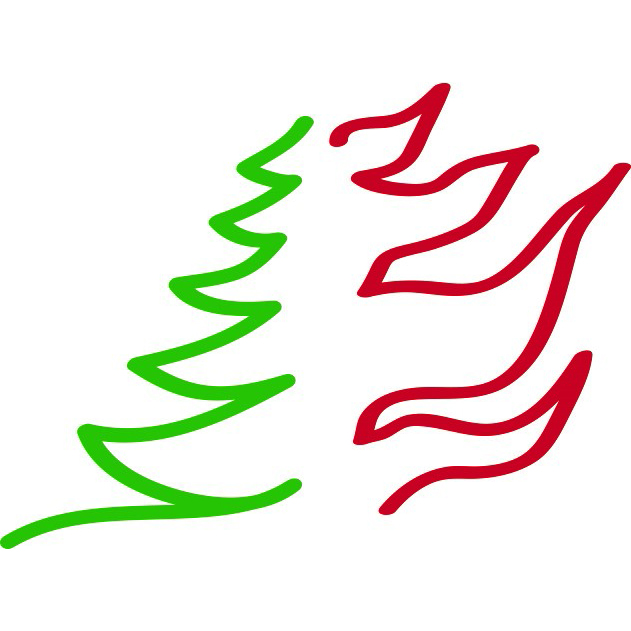Hier stehen die Illustrationen der einzelnen Module in Originalgröße zum Download als .zip bereit:
Illustrationen Modul A/1 (78.47 MB)
Illustrationen Modul A/2 (89.1 MB)
Illustrationen Modul A/3 (81.48 MB)
Abhängiges aktives Kronenfeuer
Unabhängiges aktives Kronenfeuer
Spotfeuer/Spotting/Flugfeuer
Vollfeuer mit eigener Feuerumwelt
Feuerdreieck: Brennstoff, Wärme und Sauerstoff
Flammenwinkel bei gleicher Ausbreitungsrichtung mit dem Wind und gegen den Wind (links kleiner 90 Grad, rechts größer 90 Grad)
Wärmestrahlung, Wärmeströmung und Wärmeleitung bei einem Vegetationsbrand
Verbrennungsvorgang Sauerstoff Warme Holz
Stufen der Verbrennung nach Temperatur
Sauerstoff wird angesaugt und facht das Feuer an
Bereiche eines Vegetationsbrands von oben
Arten von Vegetationsbränden
Untergrundfeuer oder Schwelbrand
Entwicklung des Welkegrads und der damit einhergehenden Abnahme des Feuchtegehalts sowie Zunahme der Brandfähigkeit
Methoden, einen Vegetationsbrand durch Entzug einer der Komponenten des Feuerdreiecks zu löschen: Entzug des Brennstoffs
Methoden, einen Vegetationsbrand durch Entzug einer der Komponenten des Feuerdreiecks zu löschen: Verringerung der Sauerstoffzufuhr
Methoden, einen Vegetationsbrand durch Entzug einer der Komponenten des Feuerdreiecks zu löschen: Reduzierung der Zündenergie
Erweitertes Feuerdreieck: Das klassische Feuerdreieck wird um die Haupteinflussfaktoren ergänzt (Brennmaterial, Topografie, Wetter)
Vegetationsbrand bewegt sich hangaufwärts. Kleiner Flammenwinkel mit einer großen Flammenlänge bedingt eine hohe Wärmestrahlung
Vegetationsbrand bewegt sich hangabwärts. Großer Flammenwinkel mit einer kurzen Flammenlänge
verursacht eine geringe Wärmestrahlung
Herabrollendes Brennmaterial
Brennmaterialentflammbarkeit abhängig von Zeit und Exposition (Campbell‘s Flammabiliy Card)
Talwindsystem um 9 Uhr morgens
In einem durchgängigen Brennmaterialbett kann sich ein Feuer ungehindert ausbreiten
Unterbrochenes Brennmaterialbett
Aufgrund der senkrechten Sonneneinstrahlung ist die Strahlungsintensität mittags bzw. nachmittags am größten und damit auch die Erwärmung des Brennmaterials
Beispielschema für die Vegetationsgesellschaft im Wald mit ihren Einflussfaktoren, die sich aus Vegetationseigenschaften und Umgebungsbedingungen ergeben
Schematische Darstellung der Bodenhorizonte und ihrer Hauptbestandteile
Der Feuchtegehalt des Brennmaterials wird durch die Sonneneinstrahlung stark beeinflusst; diese verändert sich je nach Hangneigung, Himmelsrichtung etc. im Verlauf eines Tages
Großvolumiges Brennmaterial mit einer verhältnismäßig kleinen Oberfläche
Kleinvolumiges Brennmaterial mit einer verhältnismäßig großen Oberfläche
Eine größere Oberfläche erhöht die Geschwindigkeit des Feuers
Intensität der Sonneneinstrahlung in Abhängigkeit vom Einstrahlungswinkel – vormittags
Der Querschnitt durch den Stamm zeigt die Wärmeübertragung von außen nach innen
Bei zentralisiert vorliegendem Brennmaterial erwärmen die einzelnen Holzstücke einander – dadurch entsteht ein intensiver Brand
Unterscheidung der Brennmaterialien hinsichtlich ihrer vertikalen Verteilung
Verschiedene Bodenbrennmaterialien, die sich in bis zu zwei Meter Höhe befinden können
Typischer Kiefernbestand mit unterschiedlichen Arten von Leiterbrennmaterialien, die Feuer bis in die
Krone leiten können
Auswirkungen auf das Brandgeschehen in Vegetationsformen mit unterschiedlicher horizontaler Anordnung – links sehr kompaktes, rechts locker angeordnetes Brennmaterial
Entwicklung des Welkegrads und der damit einhergehenden Abnahme des Feuchtegehalts, die zu einer Zunahme der Brandfähigkeit führt
Reflexionseigenschaften unterschiedlicher Oberflächen (Albedo-Wert)
Einfluss von Windrichtungsänderungen auf die Ausbreitung eines Feuers NW
Einfluss von Windrichtungsänderungen auf die Ausbreitung eines Feuers
Einfluss von Windrichtungsänderungen auf die Ausbreitung eines Feuers SW
Einfluss von Wind auf ein Feuer. Der Wind beugt die Flammen und bringt sie so dem Brennmaterial näher. Durch den Wind entstehende Flugfeuer fördern die schnelle Ausbreitung des Brandes
Veränderung der relativen Luftfeuchte und der Temperatur im Tagesverlauf
Feuchtigkeitsbestimmungen an feiner Vegetation durch den Einzelblatt-Test erlauben Rückschlüsse auf das
Brandverhalten
„Stockwerke“ der Atmosphäre
Luftdruck kalter und warmer Luft im Vergleich
Wasserkreislauf zwischen Meer und Land
Änderungen des Volumens und der Feuchtegehalte von warmer und kalter Luft
Thermische Tief- und Hochdruckgebiete
Luftdruck warmer und kalter Luft in der Höhe
Ablenkung der ausgleichenden Winde durch die Corioliskraft und die Bodenreibung auf der Nordhalbkugel
Positiver NAO-Index und die Auswirkung auf das europäische Wetter (nach Kachelmann)
Negativer NAO-Index und die Auswirkung auf das europäische Wetter (nach Kachelmann)
Je trockener und wärmer die Luftmassen sind, die auf Deutschland treffen, desto höher ist die Brandgefahr und desto intensiver das Feuerverhalten
Aufbau einer Frontalzyklone
Schnitt durch eine Frontalzyklone
Strahlungsbilanz der Atmosphäre
Stabilität, Labilität und Indifferenz in der Physik
Temperatur-Höhenkurve bei vertikalen Luftbewegungen mit Kondensation
Temperatur-Höhekurven von Luftpaket und Umgebungsluft bei stabiler Schichtung
Temperatur-Höhekurven von Luftpaket und Umgebungsluft bei labiler Schichtung
Beispiel für eine tatsächliche Atmosphärenschichtung
Übersicht Wolkenstockwerke in den gemäßigten Breiten
Sonneneinstrahlung im Jahresverlauf
Entstehung eines Feuerwirbels am Bergrücken durch Windscherung
Entstehungsprozess von Pyrocumulus und Pyrocumulonimbus
Räuchsäule, die auf geringe Feuerintensität hindeutet
Räuchsäule, die auf moderate bis hohe Feuerintensität hindeutet
Räuchsäule, die auf hohe bis sehr hohe Feuerintensität hindeutet
Räuchsäule, die auf extreme Feuerintensität hindeutet
Gut entwickelte Rauchsäule mit eigener Feuerumwelt (konvektiv)
Schräge Rauchsäule mit Flugfeuern